Ein eigener Kompost ist mehr als Abfallentsorgung. Aus Gartenresten und Küchenabfällen entsteht wertvolles „schwarzes Gold“ für Ihre Beete. Diese Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie Sie einen Kompost anlegen und pflegen, damit Ihr Garten eine natürliche Nährstoffquelle bekommt. Die Arbeit lohnt sich: Kompost verbessert die Bodenstruktur und -fruchtbarkeit, spart Dünger und senkt den Müllanfall.
Egal ob großer Garten oder kleiner Balkon – es gibt für jeden Platz die passende Lösung. Sie erfahren, welche Materialien geeignet sind, wo ein Kompost gut steht und wie Sie typische Fehler vermeiden. So läuft der Haufen gut und Ihre Pflanzen wachsen kräftig.
Was ist Kompost und warum lohnt sich das Anlegen?
Kompost entsteht durch die Zersetzung von organischem Material wie Garten- und Küchenabfällen. Sauerstoffliebende Mikroorganismen und Bodenlebewesen bauen die Reste ab und machen daraus Humus. Dieser Humus versorgt den Boden mit Nährstoffen und macht ihn locker und lebendig.
Ein Komposthaufen schließt den Nährstoffkreislauf im Garten. Statt Bioabfälle zu entsorgen, machen Sie daraus einen hochwertigen Dünger für Ihre Pflanzen und sparen Geld.
Die größten Vorteile für Garten und Umwelt
Kompost lockert schwere Böden und erhöht bei Sandböden die Wasserspeicherung. Das sorgt für ausgeglichene Feuchtigkeit und ein gutes Wachstum. Er liefert Nährstoffe über längere Zeit, fördert Regenwürmer und Mikroorganismen und verbessert so die Bodenstruktur. Gleichzeitig fällt weniger Biomüll an, und Sie brauchen weniger gekauften Dünger.
Welcher Standort ist ideal für einen Komposthaufen?
Ein passender Platz unterstützt den Zersetzungsprozess und hilft gegen Geruch und Schädlinge. Wichtig sind Schutz vor Wetterextremen und gute Erreichbarkeit.
Der beste Platz für Kompost im Garten
Wählen Sie einen halbschattigen, windgeschützten Standort. Starke Sonne trocknet aus, Wind weht leichtes Material weg. Büsche oder Bäume spenden Schatten und verdecken den Haufen. Legen Sie den Kompost direkt auf den Erdboden, damit Regenwürmer und andere Helfer einwandern können. Ein engmaschiges Drahtgeflecht am Boden hält Nagetiere ab, ohne den Bodenkontakt zu unterbrechen. Achten Sie auf eine gute Zufahrt mit der Schubkarre und auf ausreichend Abstand zu Haus und Nachbarn.

Kompost auf Balkon oder kleiner Fläche: Worauf achten?
Auch ohne Garten ist Kompostieren möglich. Für Balkon und Terrasse eignen sich Thermokomposter, Schnellkomposter oder Wurmkisten. Diese geschlossenen Systeme sind kompakt und meist geruchsarm, teils sogar für die Küche geeignet.
Achten Sie bei Kompostern auf UV-stabilen, wetterfesten Kunststoff. Wurmkisten machen Küchenreste zu Wurmhumus. Sie riechen kaum und liefern oft schon nach etwa drei Monaten die erste Ernte. Würmer vertragen keinen Frost, daher die Kiste im Winter an einen warmen Ort stellen. So können auch Stadtgärtner ihren eigenen Dünger herstellen.
Welches Kompostsystem passt zu mir?
Die Wahl hängt von Gartengröße, Abfallmenge und Ihren Vorlieben ab. Jedes System hat Stärken und Schwächen.
Vom Landgarten bis zum Balkon gibt es passende Lösungen. Ein System, das zu Ihren Abläufen passt, macht den Alltag leichter.
Offener Komposthaufen
Der offene Haufen (Kompostmiete) passt gut zu großen Gärten mit viel Material. Er wird frei aufgeschichtet und braucht viel Platz. Empfehlenswerte Maße: mindestens 1,20 m breit, 80 cm hoch, mehrere Meter lang, Seiten schräg. Die große Fläche belüftet gut, die Wärme geht aber schneller verloren, daher verrottet es oft langsamer als in geschlossenen Behältern. Gerüche können sich eher ausbreiten. Bei Dauerregen abdecken, damit keine Staunässe entsteht. Praktisch ist es, zwei bis drei Haufen parallel zu führen: einer in Nutzung, einer in Ruhe.
Thermo- und Schnellkomposter
Für kleine Gärten oder mittlere Abfallmengen sind geschlossene Komposter aus Kunststoff eine gute Wahl. Die Dämmung hält Wärme, beschleunigt den Abbau und hält Feuchtigkeit besser. Schnellkomposter sollten mindestens 200 Liter fassen. Achten Sie auf UV-stabilen, wetterfesten Kunststoff. Vorteile sind das schnellere Arbeiten und weniger Geruch – ideal nahe am Haus oder in kleinen Gärten.
Wurmkiste und Speziallösungen
Für Balkon und Terrasse eignen sich Wurmkisten und Bokashi. In der Wurmkiste zersetzen Kompostwürmer (Eisenia foetida) Küchenabfälle zu Wurmhumus. Eine Kiste mit 60 x 40 x 30 cm braucht rund 500 Würmer. Wurmhumus düngt Balkonkästen und Zimmerpflanzen sehr gut. Frost meiden und im Winter geschützt stellen. Im Bokashi-Eimer werden Abfälle fermentiert und später in den Boden eingearbeitet. Perfekt für wenig Platz.
| System | Platzbedarf | Tempo | Plus | Minus |
|---|---|---|---|---|
| Offener Haufen | hoch | mittel bis langsam | sehr flexibel, viel Volumen | mehr Geruch, witterungsanfällig |
| Thermo-/Schnellkomposter | mittel | schnell | kompakt, wenig Geruch | begrenztes Volumen |
| Wurmkiste/Bokashi | sehr gering | schnell | balkontauglich, ganzjährig | Frostschutz nötig (Wurmkiste) |
Welche Materialien dürfen in den Kompost – und was nicht?
Die Mischung entscheidet über die Qualität. Nutzen Sie viele verschiedene, klein zerkleinerte Materialien. Nicht alles, was „bio“ ist, passt in den Haufen.
Je bunter und feiner die Mischung, desto besser. Vorsicht bei problematischen Stoffen.
Geeignete Abfälle: Was darf auf den Kompost?
Diese Abfälle aus Garten und Küche sind geeignet:
- Rasenschnitt: Antrocknen und dünn schichten, sonst droht Fäulnis.
- Laub- und Strauchschnitt: Klein schneiden. Gut: Ahorn, Birke, Esche, Kirsche, Pappel, Obstbäume.
- Welke Blumen, Kräuter, Unkraut: Klein schneiden. Unkraut nur ohne Samen.
- Rohe Obst- und Gemüsereste: Unbehandelt ideal. Bio-Zitrus geht, verrottet langsamer.
- Tee- und Kaffeesatz: Beliebt bei Regenwürmern; Metallklammern entfernen.
- Eierschalen: Zerdrücken, liefern Kalzium und Struktur.
- Kleine Mengen Papier/Pappe: Unbedruckt, unbeschichtet, nur sparsam.
- Mist von Haustieren: In kleinen Mengen, ohne Katzenstreu.
- Algen aus dem Teich: Spenden Feuchtigkeit und Nährstoffe.
- Alte Gartenerde: Bringt Mikroorganismen ein.
Mischen Sie „grüne“ (stickstoffreiche) und „braune“ (kohlenstoffreiche) Materialien etwa 50/50. So läuft die Zersetzung gut.
Ungeeignete Stoffe: Was gehört nicht auf den Kompost?
Diese Dinge stören den Abbau, ziehen Schädlinge an oder bringen unerwünschte Stoffe ein:
- Gekochtes Essen und Speisereste: Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Brot, Teigwaren.
- Gespritzte Zitrus- und exotische Früchte: Pestizidrückstände schaden den Mikroorganismen.
- Große Zweige, Äste, Wurzeln: Verrotten sehr langsam; besser häckseln oder extra kompostieren.
- Schwer verrottendes Laub: Nussbaum, Kastanie, Eiche, Platane, Kirschlorbeer.
- Nussschalen: Nur in kleinen Mengen.
- Schnittblumen aus dem Handel: Oft behandelt.
- Unkraut mit Samen oder Wurzelunkräuter: Heimkompost wird oft nicht heiß genug. Besser Biotonne oder separat kompostieren und nur unter Bäumen ausbringen.
- Kranke Pflanzen: Krankheiten könnten sich ausbreiten.
- Farbiges, dickes, glänzendes Papier: Verrottet schlecht, enthält Chemikalien.
- Asche: Nur geringe Mengen von naturbelassenem Holz (max. 3%). Keine Briketts oder behandeltes Holz.
- Windeln, Katzenstreu, Metall, Glas, Kunststoff: Gehören in den Restmüll.

Goldene Kompost-Regeln für beste Ergebnisse
Materialien klein schneiden, damit Mikroorganismen mehr Angriffsfläche haben. „Grün“ und „braun“ gut mischen, keine Schicht dicker als 10 cm. So läuft der Prozess zügig und gleichmäßig.
Kompost anlegen: Schritt-für-Schritt Anleitung
Mit etwas Planung gelingt der Bau schnell. Die richtige Vorbereitung und Schichtung sind die Basis für guten Humus.
Gehen Sie so vor:
1. Kompostbehälter aufstellen oder Platz vorbereiten
Wählen Sie einen halbschattigen, windgeschützten Platz direkt auf Erde. Bei einem Behälter: nach unten offen aufstellen, damit Lebewesen hineingelangen und Wasser abfließen kann. Beim offenen Haufen die Fläche markieren. Ein engmaschiges Drahtgeflecht auf dem Boden hält Wühlmäuse und Ratten ab.
Achten Sie auf gute Erreichbarkeit, am besten mit Schubkarre. Wenn Sie ein Kammersystem aus Holz bauen, zuerst die Wände setzen. Eine sorgfältige Vorbereitung erleichtert den Prozess von Anfang an.
2. Schichten richtig anlegen
Ein Kompost braucht einen Wechsel aus feuchten und trockenen, groben und feinen, stickstoff- und kohlenstoffreichen Schichten. Starten Sie mit ca. 30 cm grobem, klein geschnittenem Material wie Rasenschnitt, Laub oder kleinen Zweigen für die Luftzufuhr von unten.
Darauf 5-10 cm Gartenerde als „Impfung“ mit Mikroorganismen. Ist Ihr Boden schlecht, nehmen Sie reifen Kompost oder Erde von einem funktionierenden Haufen. Streuen Sie ab und zu dünne Lagen aus kleinen Zweigen oder Holzhackschnitzeln ein, damit genug Sauerstoff in den Haufen kommt. Wechseln Sie „grün“ (Küchenabfälle, frischer Rasenschnitt) und „braun“ (Stroh, trockenes Laub, Papier) ab. Keine Schicht dicker als 10 cm. Auffüllen, bis der Haufen etwa 1,20 m hoch ist oder der Komposter voll ist.
3. Feuchtigkeit und Belüftung kontrollieren
Der Haufen soll feucht sein wie ein ausgewrungener Schwamm, aber nicht nass. Bei Trockenheit gießen, z. B. einen Eimer Wasser pro Woche. In Thermokompostern bleibt die Feuchte besser, trotzdem regelmäßig prüfen.
Für Luft sorgen, sonst entstehen Fäulnis und Geruch. Schichten Sie den Haufen regelmäßig um: Außen nach innen, innen nach außen. So kommt Sauerstoff hinein, die Zersetzung läuft schneller und gleichmäßiger. Alle paar Wochen umsetzen hält die Aktivität hoch.
4. Kompost abdecken und pflegen
Ist die gewünschte Höhe erreicht, den Haufen abdecken. Das schützt vor Austrocknung und zu viel Regen. Gleichzeitig werden weniger Insekten angezogen.
Als Deckschicht eignen sich Rasenschnitt oder Stroh. Praktisch ist auch eine Bepflanzung mit großblättrigen Kulturen wie Kürbis oder Gurke. Nach dem Abdecken beginnt die Reifephase. Weiterhin Feuchte prüfen und bei Bedarf nochmals umsetzen. So entsteht hochwertiger Humus.
Pflege und Umsetzen des Komposthaufens
Ein Kompost lebt und braucht regelmäßige Aufmerksamkeit. Richtiges Umsetzen hält den Prozess in Gang und verbessert die Qualität.
Es beschleunigt den Abbau und sorgt für gleichmäßige Ergebnisse.
Warum und wie oft sollte man Kompost umsetzen?
Wenn der Haufen nach einigen Wochen auf rund ein Drittel seines Volumens geschrumpft ist, ist ein Umschichten sinnvoll. Innen liegende, stärker zersetzte Teile kommen nach außen, frische Materialien nach innen. Vorteile:
- Luft: Sauerstoff für die arbeitenden Mikroorganismen. Ohne Luft entsteht Fäulnis und Geruch.
- Durchmischung: Gleichmäßiger Abbau und Nährstoffverteilung.
- Feuchte: Beim Umsetzen Feuchte prüfen und anpassen (gießen oder trockenes Material untermischen).
- Tempo: Mehr Aktivität, schnellere Reife.
Alle drei bis sechs Wochen umsetzen, vor allem am Anfang. Auch ohne Umsetzen reift Kompost, es dauert dann deutlich länger.
Typische Fehler und wie man sie vermeidet
Das sind häufige Probleme – und einfache Lösungen:
- Falscher Standort: Zu viel Sonne oder Wind trocknet aus. Besser halbschattig und windgeschützt.
- Zu wenig Luft: Dichte Schichten (z. B. reiner Rasenschnitt) vermeiden. Grobes Material untermischen und regelmäßig umsetzen.
- Unausgewogene Mischung: Zu viel „grün“ oder „braun“ stört das C/N-Verhältnis. Ziel: etwa 50/50.
- Falsche Feuchte: Trockener Haufen stoppt, nasser fault. Feucht wie ein ausgewrungener Schwamm halten. Bei Nässe trockenes, grobes Material zugeben.
- Unerwünschte Stoffe: Keine Speisereste, kein Fleisch, keine kranken Pflanzen, kein Unkraut mit Samen.
- Kein Bodenkontakt: Immer auf Erde anlegen, damit Helfer einwandern können.
Mit diesen Punkten und etwas Routine arbeitet Ihr Kompost zuverlässig und liefert guten Humus.
Häufige Probleme beim Kompost und wie man sie löst
Trotzdem kann es haken. Die meisten Schwierigkeiten lassen sich schnell beheben, wenn man die Signale erkennt.
Hier die häufigsten Fälle und passende Schritte.
Komposthaufen stinkt: Ursachen und Abhilfe
Geruch nach faulen Eiern oder Moder zeigt meist zu wenig Luft und/oder zu viel Nässe. Dann laufen Prozesse ohne Sauerstoff ab, und es entstehen stinkende Gase.
Abhilfe:
- Umschichten: Komplett umsetzen und gut lockern.
- Trockenes Material: Stroh, Holzhackschnitzel, zerrupfte Pappe oder trockenes Laub untermischen.
- Bodenkontakt prüfen: Wasser muss abfließen können, kein Wasserstau von unten.
- Schichten auflockern: Keine reinen, dichten Rasenschnittlagen.
Meist ist der Geruch danach schnell weg und der Haufen arbeitet wieder normal.
Schädlinge im Kompost: Vorbeugen und entfernen
Im Kompost leben viele Tiere. Manche sind nützlich, andere stören. Ratten und Mäuse kommen, wenn Futter lockt.
Vorbeugen:
- Keine Speisereste: Keine gekochten Reste, kein Fleisch, Fisch, Milch, kein Brot.
- Drahtgeflecht: Engmaschig (unter 2 cm) unter den Haufen legen.
- Frisches abdecken: Obst- und Gemüsereste sofort mit Erde oder trockenem Material bedecken.
- Geschlossene Systeme: Bei häufigen Problemen auf Thermokomposter umsteigen.
Entfernen:
Bei Befall helfen Fallen oder ein kompletter Neuaufbau nach Umsetzen. Danach Vorbeugung verstärken.
Kompost bleibt zu nass oder zu trocken: Was tun?
Die richtige Feuchte hält die Mikroorganismen aktiv. Zu viel oder zu wenig Wasser bremst den Prozess.
Kompost zu trocken:
Ursachen sind oft zu wenig Gießen oder zu viel Sonne/Wind. Die Aktivität schläft ein.
Abhilfe:
- Wässern: Regelmäßig gießen. Mit einer Stange Löcher stechen und Wasser direkt einbringen.
- Umschichten, reifen Kompost zugeben: Das belebt den Haufen.
- Schatten: Abdecken oder beschatten.
Kompost zu nass:
Er riecht faulig und wirkt schmierig. Ursachen sind zu viele feuchte Stoffe oder fehlender Wasserabzug.
Abhilfe:
- Umschichten: Gut auflockern.
- Trockenes Material: Stroh, Holzhackschnitzel, Rindenmulch, zerrupfte Pappe reichlich einmischen.
- Abfluss prüfen: Untergrund durchlässig halten.
- Abdecken: Bei Dauerregen gegen weitere Nässe schützen.
So bleibt die Feuchte im Gleichgewicht und der Abbau läuft weiter.
Wann ist der Kompost reif und wie wird er verwendet?
Mit der Zeit wird der Materialmix zu dunklem, gut riechendem Humus. Doch wann ist er einsatzbereit, und wofür nutzt man ihn am besten?
Ein paar einfache Merkmale helfen bei der Einschätzung.
Kompost-Reife erkennen: Anzeichen und Zeitrahmen
Die Dauer hängt von Mischung, Umschichten, Jahreszeit und System ab. Meist dauert es sechs bis zwölf Monate bis zur vollen Reife. Heiß aufgesetzte Haufen sind schneller, langsam gefüllte brauchen länger.
Reifer Kompost erkennt man an:
- Geruch: Riecht nach Waldboden oder Pilzen, nicht modrig.
- Struktur: Locker und krümelig; Ausgangsmaterialien kaum noch erkennbar.
- Farbe: Dunkelbraun bis schwarz.
- Temperatur: Entspricht der Umgebung.
Zum Abschluss sieben Sie den Kompost durch ein Durchwurfsieb (z. B. Hasendraht 1-2 cm). Grobe Reste wieder dem neuen Haufen zugeben – das bringt gleich aktive Mikroorganismen mit.

Tipps zur richtigen Ausbringung im Garten
Reifer Kompost ist Dünger und Bodenverbesserer. Je nach Reifestadium eignet er sich für unterschiedliche Zwecke:
- Stadium 1 (Mulch): Noch grob, neutral im Geruch, abgekühlt. Ideal als Mulch: schützt vor Austrocknung, unterdrückt Unkraut, gibt langsam Nährstoffe ab.
- Stadium 2 (Kompost-Dünger): Feiner, riecht nach Walderde. Für Starkzehrer wie Tomaten, Gurken, Kohl. 1-2 cm im Frühjahr leicht einarbeiten.
- Stadium 3 (Aussaaterde): Fein und krümelig, ohne grobe Stücke. Für Aussaat und Pflanzung, oft mit Gartenerde gemischt.
Die beste Zeit zum Ausbringen ist das Frühjahr. Im Sommer kann nachgedüngt werden. Im Herbst nur auf warmem Boden ausbringen und mit Mulch abdecken, damit Nährstoffe nicht ausgewaschen werden. Nicht übertreiben: Eine Schicht von 1-2 cm pro Jahr reicht meist, um den Boden gut zu versorgen.


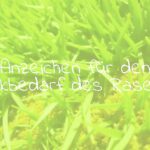
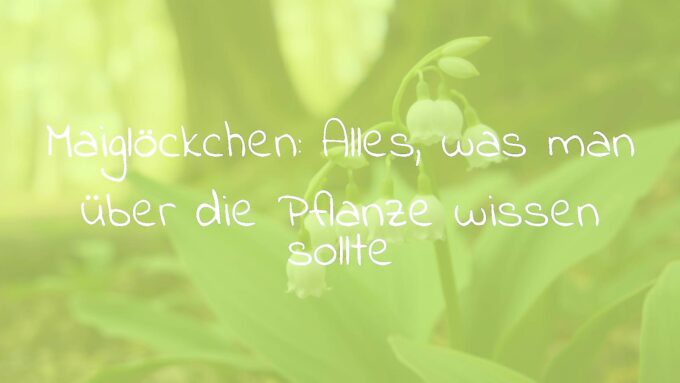
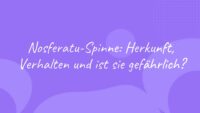



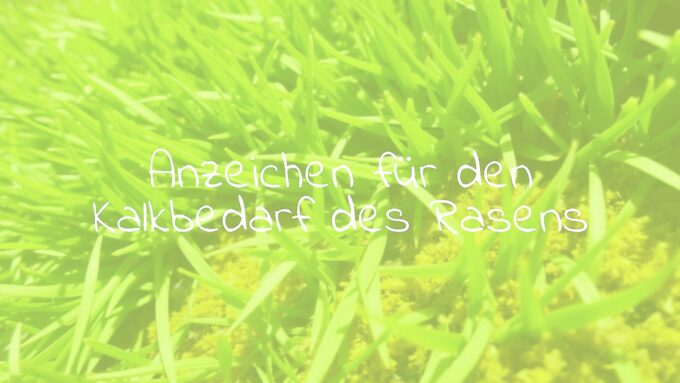
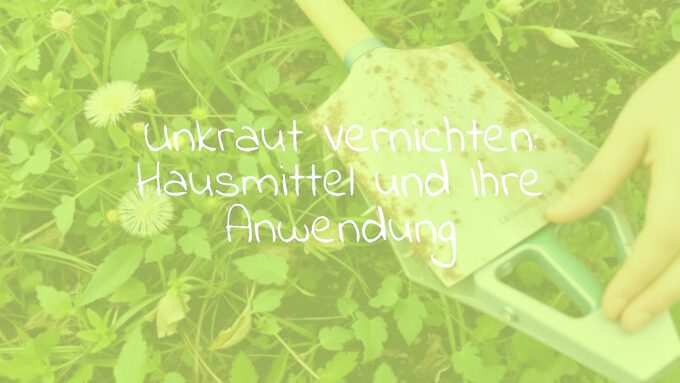
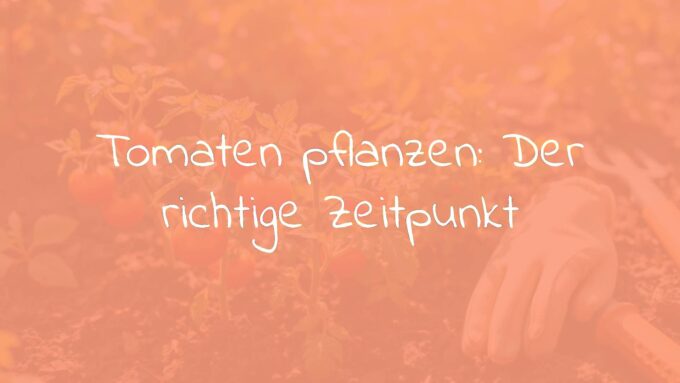

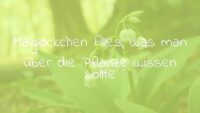
Einen Kommentar hinterlassen